
Die Rolle der Reichen
DOSSIER. Die Dramatik sozialer Ungleichheit wurde in der Ökonomie lange unterschätzt. Der Shooting Star der Ökonomie Thomas Piketty bietet mit „Capital in the 21st Century“ erstmals eine empirische Untersuchung ungleicher Eigentumsverhältnisse.
Rezension: Martin Schürz
Soziale Ungleichheit war lange Zeit für ÖkonomInnen nur ein Randthema, und die wenigen Ökonomen, die dazu arbeiteten, beschränkten sich zumeist auf Analysen der Arbeitswelt. Bei den unselbstständigen Arbeitseinkommen erwiesen sich die Unterschiede zwischen unten und oben als vergleichsweise gering. Doch bereits bei den Selbstständigen war die Datenqualität schlecht, und im Vermögensbereich entschwand alles ins Diffuse. Die Dramatik sozialer Ungleichheit wurde daher lange unterschätzt und Reichtum war sowieso kein Thema der Sozialwissenschaften.
Thomas Piketty bietet nun mit seinem Buch „Capital in the 21st Century“ erstmals eine empirische, d. h. datengeleitete Aufklärung über die ungleichen Eigentumsverhältnisse der vergangenen Jahrhunderte. Er untersucht eine Gesellschaft, deren Ungleichheit zu einem guten Teil auf vererbtem Vermögen beruht, und beschreibt mit den Einkommens-  und Vermögensverhältnissen seit dem 18. Jahrhundert die vorherrschenden Begründungen der Ungleichheit.
und Vermögensverhältnissen seit dem 18. Jahrhundert die vorherrschenden Begründungen der Ungleichheit.
Die Rendite auf Vermögen war historisch fast immer höher als das Wirtschaftswachstum. Das allein wäre noch keine aufregende Sache, sofern alle über Vermögen verfügten. Es sind aber die Reichen, die den Großteil des Vermögens halten, während der Rest der Bevölkerung bestenfalls seine Arbeitskraft zur Verfügung hat. Nur die Vermögenden und die Einkommensstarken erzielen beträchtliche Vermögenseinkommen. Folglich weitet sich die Kluft zwischen Arm und Reich. Dass größere Vermögen auch die höheren Renditen erzielen, erhöht die Ungleichheit zwischen Mitte und oben weiter. Die Reichen werden reicher. Piketty bestätigt, was die meisten ahnen.
Arbeitskonflikte und der historische Kampf der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie spielen bei Piketty eine geringe Rolle. Trotzdem sind soziale Auseinandersetzungen im ganzen Buch präsent. Denn das vordringliche Problem der Gesellschaft ist die ungleiche Verteilung. Und hier darf die geschichtliche Perspektive nicht verloren gehen: Die Nachkriegsperiode markierte eine erfreuliche Aufschwungsphase mit hoher Beschäftigung, einer starken gesellschaftlichen Mitte, die von einer neoliberalen Stagnationsphase mit steigender Ungleichheit abgelöst wurde. Viele vergleichen daher den gegenwärtigen Zeitraum des Neoliberalismus mit diesen goldenen Nachkriegsjahren und schließen, dass es gesellschaftspolitisch um die Rückkehr zum nationalstaatlich organisierten Keynesianismus ginge. Geht man aber bis ins 18. Jahrhundert zurück, erweist sich die vermeintliche Normalität der Nachkriegsjahrzehnte als eine kurze historische Ausnahme von einem langen historischen Trend massiver sozialer Ungleichheit und bescheidener Wachstumsraten.
Wobei das Wirtschaftswachstum, der Wohlstand in einem Land, von Verteilungsfragen unterschieden werden muss. Auch wenn das BIP wächst, bedeutet das nicht, dass für alle der Lebensstandard steigt. Zwar mag die Wahrscheinlichkeit einer Besserstellung auch für Einkommensarme steigen, in den vergangenen Jahren traf das aber nicht zu. Die Wachstumszuwächse landeten alle bei den Reichen. Piketty analysiert daher den Anteil der obersten zehn Prozent (eine Welt für sich) und des obersten einen Prozent der Bevölkerung (eine dominante Welt). Macht es Sinn, einen so kleinen Teil der Bevölkerung zu betrachten? In absoluten Zahlen sind das gar nicht so wenige, in Österreich fast 40.000 Haushalte. Zudem kann diese kleine Gruppe einen großen Einfluss auf die Gesellschaftsordnung und das politische System haben. Piketty gelingt es damit, Reichtum in Relation zu Armut zu stellen und zu zeigen, wie wenig die Vielen und wie viel die Wenigen haben. Im 18. und 19. Jahrhundert lag der Anteil der Top-10-Prozent bei 90 Prozent des gesamten Vermögens, jener des obersten Prozents der Bevölkerung bei 60 Prozent. Heute verfügen die reichsten 10 Prozent der Bevölkerung über 60 bis 70 Prozent der Vermögen und das reichste eine Prozent über 20 bis 30 Prozent. Die untere Hälfte besitzt weiterhin fast nichts, sie liegt unter 5 Prozent. Das zeigt, dass jene recht haben, die vermuten, dass die Armen arm bleiben und die Reichen reicher werden.
Erben steht im Mittelpunkt
Wie aber soll nun Ungleichheit betrachtet werden? Auf globaler Ebene, mit Vergleichen zwischen China, Afrika und den USA, oder jeweils auf nationaler Ebene? Global sind in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Milliarden Menschen der Armut entkommen. Das ist erfreulich, der Fokus von Piketty ist aber ein anderer. Er betrachtet das Verteilungsthema im Hinblick auf Reichtum. Absolute Armut (Hunger) kann verringert werden, ohne dass die gravierenden Reichtums- und Verteilungsprobleme tangiert werden. Die weltweit agierenden Reichen gibt es in allen Ländern, daher muss das Problem der Vermögenskonzentration global mit einer progressiven Vermögenssteuer, vielleicht initiiert durch die G 20, angegangen werden.
Statistische Fragen sind für viele langweilig. Sie sind aber gerade in Verteilungsdebatten unverzichtbar. Piketty zeigt die Verschränkung von Politik mit den Interessen der Vermögenden und ihre negativen Folgen für die Datentransparenz. Gute Statistiken zur Verteilung haben ein gesellschaftsveränderndes Potenzial, und wo sie fehlen, leidet auch der Gerechtigkeitsdiskurs. Statistiken über die Anteile der Reichen machen sichtbar, was Vermögende gern unter den Teppich kehren: jene Ungleichheit, die nicht auf Leistungsunterschieden oder Zufall beruht, sondern auf Klassenprivilegien. Die Französische Revolution war es, die ein Vermögenssteuerregister ermöglichte und großartige Debatten zum Erbrecht einleitete. Die Forderung Pikettys, die Steuerbehörden mit Informationen zu versorgen, um das Nettovermögen der StaatsbürgerInnen zu berechnen, ist wichtig. Sie entspringt nicht dem Wunsch, im Privaten zu schnüffeln, sondern ist als Basis für vernünftige Debatten notwendig. Etwa zur Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen.
Meritokratie, das Prinzip, dass die, die mehr leisten, auch mehr verdienen sollen, ist eine ideologische Säule zur Rechtfertigung von Einkommensungleichheit im Kapitalismus. Ungleichheit liefere einen Anreiz, mehr zu leisten; Reichtum ist wie der verdiente Lohn dafür. Bei Vermögen wird extreme Ungleichheit sowie die exklusive Stellung der Superrentiers (Piketty) schon schwieriger zu rechtfertigen. Piketty enttarnt die Versprechen von den gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten als Worthülsen.
Es besteht sogar die Gefahr, dass die Meritokratie selbst zum gesellschaftlichen Auslaufmodell wird. Zwar hat sie in der Wirklichkeit ohnedies nicht gegolten, zur Rechtfertigung von Ungleichheit war sie aber wichtig, weil sie Hoffnungen befeuerte. Wenigstens kurz konnte man glauben, dass die SiegerInnen nicht schon am Start feststehen. Doch unsere Gesellschaft beginnt jener des 19. Jahrhunderts mit ihren verfestigten Sozialstrukturen zu ähneln. Das geerbte Vermögen ist in dieser Welt entscheidend.
Erben steht bei Piketty deshalb im Zentrum. Bei den leistungslosen Erbschaften kollabiert die Legitimation der Ungleichheit über Leistung. Im 19. Jahrhundert gab es zehn Prozent der Bevölkerung, die mehr erbten als die untere Bevölkerung in ihrem Leben verdiente. Im 20. Jahrhundert sank der Anteil der reichen Erben, die allein von ihrer Erbschaft leben konnten, auf zwei Prozent. Kriege und Steuern hatten die Bedeutung der Erbschaften sinken lassen. Doch im 21. Jahrhundert dreht sich das wieder. Die Kohorten der nach 1970 Geborenen können wieder größere Erbschaften erwarten. Geerbt wird das Vermögen des wohlhabenden Teils der Nachkriegsgeneration. Piketty diagnostiziert, dass die Gruppe jener Menschen, die nichts arbeiten müssen, weil sie von der Erbschaft leben können, auf zwölf Prozent anwächst.
Viele Fragen zur gesellschaftlichen Dynamik der Reichtumsentstehung bleiben auch nach Pikettys Buch offen. Welche Rolle können Gewerkschaften noch spielen, sind kritische Diskurse erfolgversprechend, oder verpufft alles im resignativen Räsonieren? Reicht die Hoffnung auf die Einsicht von Fiskalbehörden und deren internationale Kooperation aus? Ob Letzteres realistisch ist oder nicht, ist nur schwer zu beurteilen. Hier zeigt sich Piketty optimistisch. Trotzdem, weiterhin wissen wir zu wenig über Reichtum. Die nötige Datentransparenz herzustellen bleibt eine überfällige Aufgabe des Staates, insbesondere in Österreich. Der Anstieg der Reichtumskonzentration ist jedenfalls bedrohlich. Es entstehen neue soziale Trennlinien. Rentiers, Erben und Supermanager haben nur geringes Interesse am öffentlichen Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystem. Diese Abkoppelung der dominanten Welt des Top-1-Prozent wird die Demokratie zwangsläufig schwächen. Die Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts droht zurückzukehren.
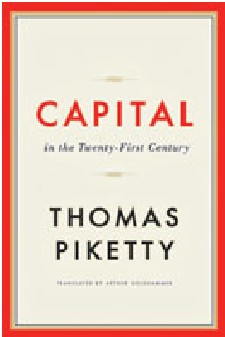
Thomas Piketty
Das Kapital im 21. Jahrhundert
912 Seiten
Verlag: C.H. Beck
Unterstützen Sie jetzt unabhängigen Menschenrechtsjournalismus mit einem MO-Magazin-Solidaritäts-Abo


